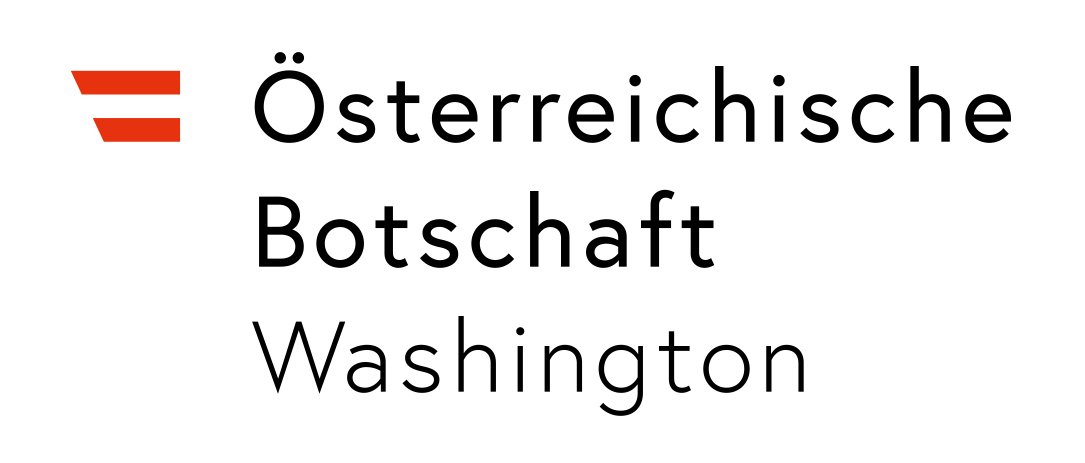Menschenrechte
Kampf gegen Rassismus
Einer der grundlegendsten Menschenrechtsgrundsätze ist die gleiche Würde und die gleichen Rechte aller Menschen. Diese Gleichheit ist in Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und in Artikel 7 der österreichischen Bundesverfassung verankert. Auch Artikel 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention verbietet Diskriminierung und besagt, dass Menschen nicht aufgrund persönlicher Merkmale wie Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, nationaler oder sozialer Herkunft, Religion, Sprache oder Meinung ungleich behandelt oder diskriminiert werden dürfen.
Ausgehend von diesem Grundsatz der Gleichheit aller Menschen fordert das UN-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung von 1965, zu dessen Vertragsstaaten auch Österreich gehört, alle Staaten auf, konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung der Diskriminierung von Personen aufgrund ihrer Hautfarbe oder ethnischen Herkunft zu ergreifen. Zur Überwachung der staatlichen Aktivitäten zur Bekämpfung der Rassendiskriminierung wurde ein Ausschuss zur Beseitigung der Rassendiskriminierung eingerichtet. Der kombinierte 18./19./20./14. österreichische Staatenbericht wurde dem Komitee im Dezember 2011 übermittelt und im August 2012 in Genf im Beisein einer großen österreichischen Delegation geprüft. Die Empfehlungen des Komitees nach dieser Prüfung wurden im Dezember 2012 veröffentlicht.
Die Vereinten Nationen haben den 21. März zum Internationalen Tag für die Beseitigung der Rassendiskriminierung erklärt und drei Weltkonferenzen gegen Rassismus veranstaltet (1978, 1983, 2001). Zuletzt fand 2009 in Genf eine Konferenz zur Überprüfung der UN-Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz statt, die 2001 in Durban, Südafrika, abgehalten wurde. Das Ergebnis war eine neue Erklärung, in der die Erklärung und das Aktionsprogramm von Durban zur weltweiten Bekämpfung von Rassismus, Diskriminierung und Intoleranz bekräftigt wurden. Österreich engagiert sich im Rahmen der Vereinten Nationen und anderer internationaler Organisationen aktiv für die Bekämpfung von Rassismus und setzt sich bei Konferenzen und Treffen stets für konkrete und konstruktive Ergebnisse ein.
Auch intern legt Österreich großen Wert auf die Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und ergreift konkrete Maßnahmen auf allen Ebenen, d.h. Förderung der Gleichbehandlung, Bekämpfung von Stereotypen und Förderung der Integration. So wurde zum Beispiel der strafrechtliche Schutz vor Diskriminierung und Hassverbrechen in den letzten Jahren erheblich verstärkt. Der Grundsatz der Gleichbehandlung ist in der österreichischen Verfassung verankert. Auf dieser Grundlage wurde eine umfassende Antidiskriminierungsgesetzgebung verabschiedet, die ständig verbessert wird. Im Bereich des Verwaltungs- und Zivilrechts hat die Umsetzung der EU-Leitlinien zur Durchsetzung von Antidiskriminierungsvorschriften den österreichischen Gesetzgeber weiter gestärkt.
Darüber hinaus werden auch nicht-legislative Maßnahmen ergriffen, insbesondere in den Bereichen Bildung, Ausbildung und Sensibilisierung. Diese Maßnahmen werden mit dem bestehenden Nationalen Aktionsplan Integration weiter ausgebaut und verstärkt. Schließlich sieht das neue Regierungsprogramm (2013-2018) die Ausarbeitung eines allgemeinen nationalen Aktionsplans für Menschenrechte vor, der zu weiteren Fortschritten in diesem Bereich führen wird.
Im Jahr 2002 richtete der Europarat die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) ein, deren Aufgabe es ist, die Gesetzgebung und andere Maßnahmen der Mitgliedstaaten in Bezug auf Rassismus und Intoleranz zu überwachen und Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. Zu diesem Zweck führen unabhängige Experten auch Länderbesuche durch. Österreich wurde zuletzt im Jahr 2004 von ECRI besucht und der Bericht über diesen Besuch wurde im Februar 2005 veröffentlicht. Der nächste Besuch ist für November 2014 geplant.
Die menschliche Dimension der OSZE bekämpft auch alle Formen von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Diskriminierung unter der Schirmherrschaft des OSZE-Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR) in Warschau. Daten und Informationen über Rassismus und Diskriminierung werden mit Hilfe eines Informationssystems für Toleranz und Nichtdiskriminierung gesammelt. Darüber hinaus sind im Rahmen der OSZE drei Sonderbeauftragte im Bereich der Toleranz tätig:
Persönlicher Beauftragter für die Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung, Catherin McGuiness
Persönlicher Beauftragter für die Bekämpfung des Antisemitismus, Rabbiner Andrew Baker
Persönlicher Beauftragter für die Bekämpfung von Intoleranz und Diskriminierung von Muslimen, Ömür Orhun,
Auch die Hohe Kommissarin der OSZE für nationale Minderheiten, Astrid Thors, und die OSZE-Beauftragte für Medienfreiheit, Dunja Mijatovic, tragen mit ihrer Arbeit zum Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit bei.
Innerhalb der EU hat Österreich der Europäischen Agentur für Grundrechte (FRA), die 2007 aus der ehemaligen Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (EUMC) hervorgegangen ist, kontinuierliche Unterstützung angeboten. Als zentrale Anlaufstelle für Menschenrechtsfragen innerhalb der EU gibt die FRA den EU-Institutionen und den Mitgliedstaaten Empfehlungen zur Einhaltung von Menschenrechtsstandards in allen Phasen des EU-Gesetzgebungsprozesses und der Politikentwicklung. Die Hauptaufgaben der Agentur bestehen darin, relevante, objektive, verlässliche und vergleichbare Informationen und Daten über die Lage der Grundrechte in den EU-Mitgliedstaaten zu sammeln, zu erfassen, zu analysieren und zu verbreiten, wissenschaftliche Untersuchungen und Erhebungen, vorbereitende Studien und Durchführbarkeitsstudien durchzuführen, Schlussfolgerungen und Stellungnahmen zu bestimmten Themen für die Organe der Union und die Mitgliedstaaten bei der Durchführung des Gemeinschaftsrechts entweder auf eigene Initiative oder auf Ersuchen des Europäischen Parlaments, des Rates oder der Kommission zu formulieren und zu veröffentlichen sowie den Dialog mit der Zivilgesellschaft zu fördern, um die Öffentlichkeit für die Grundrechte zu sensibilisieren und Informationen über ihre Arbeit aktiv zu verbreiten.