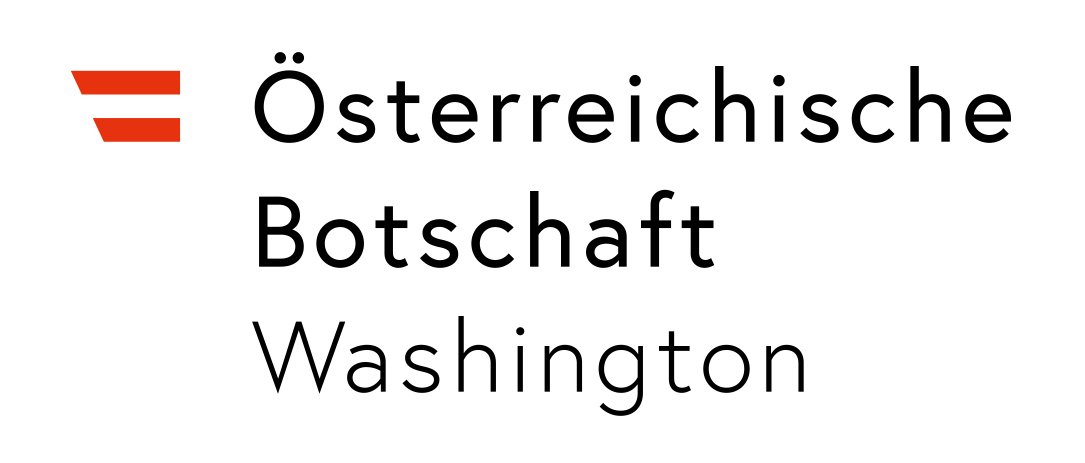Die Conrad- und Sonnblick-Sternwarten
Den Puls der Erde fühlen
Wenn man das Conrad-Observatorium betritt, fühlt man sich plötzlich wie in der Kulisse eines James-Bond-Films: zwei Kilometer lange Schächte und Tunnel tief in einem Berg 50 Kilometer südwestlich von Wien und blinkende Lichter von bizarren Instrumenten. Diese Instrumente messen weltweit Erdbeben und Explosionen von Atomtests sowie kleinste Veränderungen der Erdanziehungskraft und des Magnetfelds und sind Teil von Detektionssystemen für Sonnenstürme zum Schutz des österreichischen Stromnetzes.
Das Conrad-Observatorium der Österreichischen Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) ist ein geophysikalisches Observatorium mit mehreren Beobachtungs- und Forschungseinrichtungen, das grundsätzlich alle Bereiche der Geowissenschaften abdeckt. "Die Abgeschiedenheit des Standortes ist ideal für geophysikalische Untersuchungen. Es ist das einzige Observatorium dieser Art im gesamten Alpenraum", sagt Roman Leonhardt, Leiter des Observatoriums. "Der Standort zeichnet sich durch eine extrem niedrige Geräuschkulisse aus, sowohl natürlich als auch technisch, und garantiert konstante Temperaturbedingungen für alle Messverfahren und Experimente. Zudem reduziert die Konstruktion als unterirdisches Observatorium die Oberflächenvibrationen.
Das Observatorium verfügt über eine eigene, unterbrechungsfreie Stromversorgung und ist über Datenübertragungsleitungen mit der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien verbunden. Grundsätzlich können alle Prozesse und Experimente ferngesteuert werden." Die Bandbreite der unterstützten Messmethoden, die Instrumentierung und die Ausstattung der Observatorien machen sie zu einem einzigartigen Forschungs- und Entwicklungsstandort für Geowissenschaftler aller Disziplinen. Zu den Erdprozessen, die am Conrad-Observatorium kontinuierlich beobachtet werden, gehören globale Erdbeben, Erdgezeiten, Magnetfeldschwankungen, geodätische Parameter sowie atmosphärische Wellen und meteorologische Daten.
Die genaue Messung und kontinuierliche Überwachung all dieser Schwankungen ist für unser Verständnis von Ursache und Wirkung dieser grundlegenden geophysikalischen Prozesse unerlässlich. Das Observatorium ist Mitglied der wichtigsten internationalen Netzwerke für jedes Forschungsgebiet wie IRIS (Seismologie) und INTERMAGNET (Magnetismus). Die Datenqualität wird häufig als hervorragend bewertet und weltweit von bekannten Institutionen wie NOAA und ESA genutzt. Neben den Beobachtungsinstrumenten sind am Conrad-Observatorium mehrere Forschungs- und Kalibrierungseinrichtungen installiert.
Diese Infrastruktur umfasst Kalibrierungssysteme für Seismometer und magnetische Sensoren, Referenzstationen sowie Labors für Materialforschung und Magnetismus und wird von vielen verschiedenen nationalen und internationalen Partnern genutzt. Ein aktuelles Beispiel ist die Nutzung des Merritt-Spulensystems, einer magnetischen Kalibrierungsanlage, die in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Institut für Weltraumforschung (IWF) installiert wurde. Sie ermöglicht eine präzise Kalibrierung von magnetischen Sensoren in einer magnetisch sehr sauberen Umgebung. Derzeit wird in diesem Spulensystem ein vom IWF entwickelter absoluter Skalarsensor für die erste große Jupitermission der ESA untersucht. Ab 2022 wird es Teil von JUICE sein, der ersten europäischen Satellitenmission zum äußeren Sonnensystem, die das Magnetfeld des Jupiters und seiner Monde erforschen soll.
Das Conrad-Observatorium ist nach dem österreichisch-amerikanischen Geophysiker Victor Conrad benannt. Er ist in der Erdbebenforschung vor allem dafür bekannt, dass er eine Grenzschicht in der Erdkruste vorgeschlagen hat, die später als "Conrad-Diskontinuität" in die Wissenschaft eingegangen ist. Victor Conrad wurde 1904 zum ersten Leiter des Österreichischen Erdbebendienstes an der ZAMG ernannt und arbeitete viele Jahre für diese Institution. Er beendete seine Karriere an der Harvard University in Cambridge, Massachusetts, wo er bis zum Alter von 80 Jahren als Lehrer und Forscher tätig war.
Wissenschaft über den Wolken: Das Sonnblick-Observatorium
Ein visionärer Wissenschaftler und ein durchsetzungsfähiger, an der Natur interessierter Geschäftsmann legten den Grundstein dafür, dass aus einer - vorsichtig ausgedrückt - sehr anspruchsvollen Idee eine wissenschaftliche Erfolgsgeschichte mit weltweiter Bedeutung wurde. Einer davon war Julius Hann, von 1877 bis 1897 Direktor der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Er förderte den Ausbau von Bergwetterstationen zur Erforschung höherer Atmosphärenschichten. Der andere war Ignaz Rojacher, Besitzer eines Goldbergwerks in Rauris, Salzburg. Nachdem er mehrere Gipfel in seiner Region bestiegen hatte, kam er zu dem Schluss, dass er einen idealen Standort für eine meteorologische Messstation gefunden hatte: den freistehenden Gipfel des Hohen Sonnblicks auf 3.106 Metern Seehöhe.
Der Bau des Observatoriums begann im Frühsommer 1885. Das Material wurde mit improvisierten Seilbahnen aus Holz und zu Fuß auf den Gipfel gebracht. Die Eröffnung des Sonnblick-Observatoriums fand am 2. September 1886 statt. Heute ist das Sonnblick-Observatorium der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Österreichs ein international gefragter Forschungsstandort. Ihr Forschungs- und Überwachungsprogramm gliedert sich in die drei Teilprogramme Atmosphäre, Kryosphäre und Biosphäre und konzentriert sich insbesondere auf Klima- und Umweltstudien.
Das Observatorium befindet sich auf dem Gipfel des Hohen Sonnblicks, etwa 120 km südlich der Stadt Salzburg auf einer Höhe von 3.106 Metern, eingebettet in die Kernzone des Naturschutzgebietes Nationalpark Hohe Tauern. "Das Sonnblick-Observatorium verfügt mit mehr als 130 Jahren über eine der längsten kontinuierlich gemessenen Temperatur-Zeitreihen der Welt in solchen Höhenlagen. Seine einzigartige Lage ermöglicht klimarelevante CO2-Messungen, die den steigenden Trend der letzten 20 Jahre unterstreichen", sagt Elke Ludewig, Leiterin des Observatoriums und ehemalige Wissenschaftlerin der Polarforschungsstation Neumayer III in der Antarktis.
Das Sonnblick-Observatorium ist über eine private Seilbahn erreichbar, die auch für Profilmessungen zwischen Tal und Gipfel genutzt werden kann. Durch die installierte Stromversorgung und den privaten Zugang ist der Stationsstandort nahezu emissionsfrei, ein Vorteil für atmosphärische Hintergrundstudien. Ein redundantes Telekommunikationssystem ermöglicht den Fernzugriff und die Bereitstellung von Daten nahezu in Echtzeit.
Das Sonnblick-Observatorium ist rund um die Uhr mit mindestens zwei Technikern vor Ort. Das Sonnblick-Team unterstützt Projekte, indem es bei der Entnahme von Sonden, bei Beobachtungen oder bei der Wartung und dem Betrieb von Instrumenten hilft, wenn die Wissenschaftler nicht vor Ort sind. Mehrere Universitäten und Forschungseinrichtungen nutzen die Infrastruktur und die Dienstleistungen des Standorts für ihre Projekte. Was vor mehr als 130 Jahren mit einer verrückten Idee begann, ist heute ein wichtiger Beitrag für die Menschheit.
Weitere Informationen: https://www.zamg.ac.at/cms/en/news