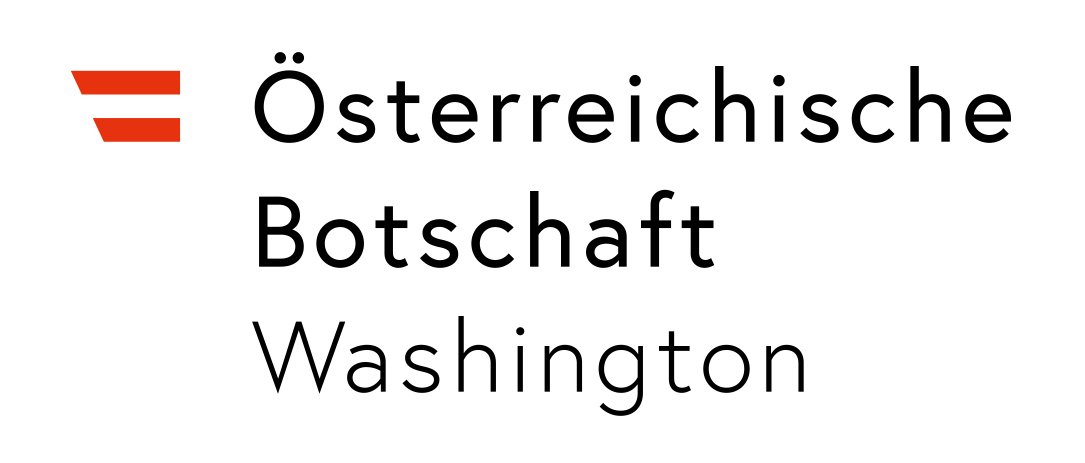Transatlantische Perspektiven: Matthias Troyer
Matthias Troyer
Wann und aus welchen Gründen sind Sie in die USA gezogen?
Während meiner Tätigkeit als Professor an der ETH Zürich in der Schweiz habe ich Microsofts Quantenbestrebungen mehr als ein Jahrzehnt lang durch Forschungskooperationen und als Berater unterstützt. Im Jahr 2017 war die Zeit reif für ein Vollzeit-Engagement und ich zog in die Gegend von Seattle, um eine führende Rolle beim Aufbau des auf topologischen Qubits basierenden Quantencomputers von Microsoft zu übernehmen.
Was zeichnet Ihrer Meinung nach die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Österreich/Europa und den USA aus, nicht nur, aber auch im Bereich der Quantenwissenschaft?
Seit dem Zweiten Weltkrieg haben Europa und die Vereinigten Staaten jahrzehntelang eine enge wissenschaftliche Zusammenarbeit gepflegt. In einigen Bereichen der Wissenschaft war ein Aufenthalt in den USA fast schon ein Initiationsritus für einen Wissenschaftler. Die Wissenschaftsgemeinschaften sind eng miteinander verbunden - man könnte sogar im Quantenjargon sagen verschränkt - und profitieren voneinander.
Was sind die Stärken und Schwächen der Quantenwissenschaft und Quantentechnologie in den USA und in Österreich/Europa? Können sie sich gegenseitig ergänzen oder voneinander lernen?
Europa zeichnet sich durch Grundlagenforschung und eine stabile Finanzierung innovativer Ideen aus, insbesondere in der Quantenwissenschaft. Sein Bildungssystem fördert die MINT-Fächer, unterstützt durch eine gut finanzierte universitäre Forschung. Die Stärke der USA liegt in ihren erstklassigen akademischen Einrichtungen, ihrem Unternehmergeist und ihren Technologieunternehmen, die das Risiko auf sich nehmen, akademische Entwicklungen in Produkte umzusetzen.
Mein eigener Weg spiegelt dies gut wider: Nach einer Ausbildung in Linz und Zürich verbrachte ich meine akademische Laufbahn in Europa - mit Möglichkeiten, die ich in den USA nicht gehabt hätte - bis das Quantenfeld reif genug war, um die Gelegenheit zu ergreifen, an Microsofts ehrgeizigen, aber risikoreichen Bemühungen zum Bau eines skalierbaren Quantencomputers teilzunehmen. Dann hörte ich von hohen europäischen und schweizerischen Regierungsebenen, dass "die USA Europas Top-Talente im Quantenbereich abwerben". Ich musste darüber schmunzeln und antwortete, dass ich nicht abgeworben wurde, sondern eine Gelegenheit nutzte, die es in Europa nicht gab
Es gibt Möglichkeiten für die Vereinigten Staaten und Europa, voneinander zu lernen. Der Start der Nationalen Quanteninitiative in den USA wurde durch europäische und chinesische Investitionen in diesem Bereich inspiriert und verdeutlicht die Notwendigkeit einer konsistenten Finanzierung der Grundlagenforschung in den USA - und das Risiko einer solchen Finanzierung unter der derzeitigen Regierung. Umgekehrt besteht für Europa die Chance, mehr unternehmerische Praktiken zu übernehmen, sich neben akademischen Veröffentlichungen auf die Produktentwicklung zu konzentrieren und ein höheres Maß an Risikobereitschaft zu zeigen.
Was würden Sie sich für die transatlantische Zusammenarbeit wünschen?
Die transatlantische Zusammenarbeit in der Quantentechnologie muss offen bleiben, mit freiem Austausch von Ideen und Menschen. Meine Erfahrung und meine Reise zeigen, dass kein einzelnes Land allein einen skalierten Quanten-Supercomputer für globale Herausforderungen bauen kann. Wir müssen wachsam bleiben, da offene Grenzen bedroht sind, wie z.B. der Ausschluss der Schweiz von Quantenprojekten durch die EU oder Länder, die einseitige Kontrollen der Quantentechnologie erwägen.
Wie sehen Sie die zukünftige Rolle der Quantenwissenschaft und -technologie? Wohin wird die Reise gehen?
Ein Jahrhundert nach der Geburt der Quantenmechanik wird das Quantencomputing zur Realität. Obwohl wir noch ganz am Anfang stehen, sehen wir bereits ein großes Versprechen. Die ersten Anwendungen des Quantencomputings könnten im Bereich der Chemie und der Materialien liegen. Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der generative KI neue Moleküle oder Materialien mit den gewünschten Eigenschaften entwirft. Sie werden Ihren KI-Assistenten bitten können, bessere Legierungen für die Weltraumforschung zu entwickeln, nachhaltige Alternativen für toxische Substanzen zu entwickeln, Kunststoffabfälle in wertvolle Rohstoffe zu verwandeln oder Kohlenstoff aus der Luft zu binden. Das Quantencomputing wird diese Zukunft ermöglichen.
Was muss Österreich Ihrer Meinung nach tun, um in dieser Spitzenforschung mit der Welt mithalten zu können?
Der Technologiesektor erlebt derzeit einen Wandel, der durch eine industrielle Revolution gekennzeichnet ist, die von Fortschritten in der künstlichen Intelligenz (KI) angetrieben wird. Diese Revolution verändert bereits die Interaktion zwischen Mensch und Computer, wie die neuen Fähigkeiten von ChatGPT zeigen. Darüber hinaus beschleunigen neue KI-Modelle mit logischen Fähigkeiten die wissenschaftlichen Entdeckungen. In meinem Team ist es uns gelungen, innerhalb von Wochen innovative Batteriematerialien zu entwickeln, ein Prozess, der traditionell Jahre dauert. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es für Österreich und Europa unerlässlich, die KI-Revolution in allen Bereichen, einschließlich Bildung, Forschung, Produktentwicklung und Produktion, voll zu nutzen.
Österreich muss weiterhin erstklassige Forschung an unseren führenden Einrichtungen finanzieren. Wir müssen unser starkes Bildungssystem nutzen, aber auch unsere Bemühungen verstärken, die Forschung in Produkte umzusetzen. Letzteres wird wahrscheinlich Finanzmittel in einer Höhe benötigen, die einem kleinen Land wie Österreich nicht zur Verfügung steht und eine europäische Zusammenarbeit erfordert. Ich rechne mit zukünftigen Durchbrüchen und Quantennobelpreisen aus Österreich.
Matthias Troyer Bio
Dr. Matthias Troyer ist Technical Fellow und Corporate Vice President bei Microsoft und arbeitet an der Systemarchitektur von Quantencomputern und deren Anwendungen.
Geboren und aufgewachsen in Österreich, in Linz und in der Nähe von Innsbruck, studierte er Physik an der Universität Linz und der ETH Zürich. Nach seiner Promotion im Jahr 1994 an der ETH Zürich in der Schweiz und einem Aufenthalt als Postdoc an der Universität Tokio war er bis zu seinem Wechsel zu Microsoft im Jahr 2017 Professor für Computerphysik an der ETH Zürich.
Er ist ein Fellow der American Physical Society und Präsident des Aspen Center for Physics. Er ist Träger des Rahman-Preises für Computerphysik der American Physical Society "für bahnbrechende numerische Arbeiten in vielen scheinbar unlösbaren Bereichen der Quantenvielkörperphysik und für die Bereitstellung effizienter, hochentwickelter Computercodes für die Gemeinschaft" sowie des Hamburger Preises für Theoretische Physik.