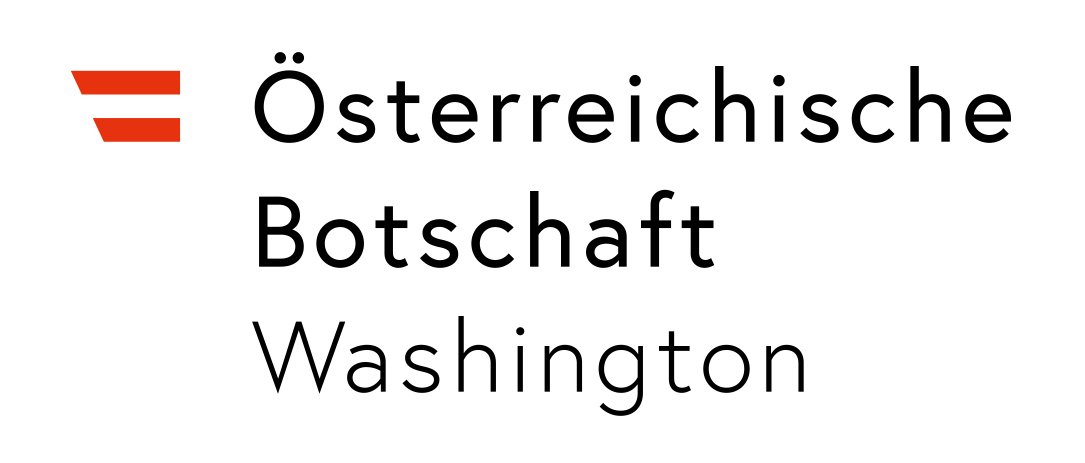Transatlantische Perspektiven: Jörg Schmiedmayer
Jörg Schmiedmayer
Sie haben mehrere Jahre als Postdoktorand und Gastwissenschaftler in den USA verbracht. Wie haben Sie Ihre Zeit in den USA erlebt? Wie war die Zusammenarbeit mit Ihren amerikanischen und internationalen Kollegen? Wie haben Sie sie und diese Zusammenarbeit empfunden und wahrgenommen?
Ich habe viel Zeit im OakRidge National Lab in Tennessee, um einige Experimente an deren gepulster Neutronenquelle durchzuführen, und dann fast 4 Jahre, zuerst in Harvard und dann am MIT. Tennessee und Cambridge MA waren völlig unterschiedlich, was mir einen Einblick in die Bandbreite des sozialen Umfelds in den USA verschaffte. Selbst als jesuitisch erzogener Wiener waren die Bedeutung und die teilweise Dominanz der Religion in Teilen der USA eine Überraschung für mich.
Andererseits war das wissenschaftliche Umfeld an all diesen Orten sehr offen, integrativ und ausgezeichnet. Ich fühlte mich sehr gedemütigt durch die einladende Haltung selbst der prominentesten Wissenschaftler, was in krassem Gegensatz zu einigen Erfahrungen stand, die ich in Wien gemacht hatte, wo einige die Exzellenz für sich beanspruchten, indem sie weder nach links noch nach rechts schauten. Besonders in Cambridge MA war die Gemeinschaft, die aus der ganzen Welt zusammenkam und in der es keine Rolle spielte, woher man kam und in welcher Wissenschaft man tätig war, sehr anregend. Wer 'amerikanisch' und wer 'international' ist, kam nie zur Sprache. In der Wissenschaft war der Drang nach neuem Wissen und Verständnis sehr ansteckend, vor allem in unserem Bereich der Materiewelleninterferometrie, der ultrakalten Atome und der Quantenphysik, die gerade ihre erstaunliche Entwicklung begann, die nun schon mehr als 30 Jahre andauert.
Vor allem während meiner Zeit in Harvard und am MIT habe ich viele Freunde aus der ganzen Welt gefunden. Mit vielen von ihnen stehe ich immer noch in engem Kontakt, privat und in der wissenschaftlichen Zusammenarbeit. Für mich war meine Zeit in den USA definitiv prägend für meine Sicht auf die Wissenschaft und wie ich Universitäten und Lehre sehe.
Hat sich das in Ihren Augen in letzter Zeit geändert?
Die Wissenschaft war immer sehr wettbewerbsorientiert, aber damals war sie unpolitisch. Im Kreis meiner Freunde und Mitarbeiter hat sich nicht viel geändert, außer dass wir jetzt alle 30 Jahre älter sind, aber in unseren Diskussionen über Themen kommen die Politik und die Auswirkungen der Politik auf die Wissenschaft viel häufiger zur Sprache als früher.
Wie beurteilen Sie die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Österreich und den USA? Welche Beispiele fallen Ihnen ein?
Für mich war die Zusammenarbeit immer sehr persönlich, mit bestimmten Wissenschaftlern und ihren Postdocs und Doktoranden. Ich war nie ein Fan der von großen Institutionen/Gruppen organisierten Zusammenarbeit.
Was sind die Stärken und Schwächen der Quantenwissenschaften in den USA und Österreich? Können sie sich gegenseitig ergänzen oder voneinander lernen?
Die USA sind klar im Vorteil, wenn es um konzentrierte Anstrengungen geht, um bestimmte Richtungen voranzutreiben. Die konzentrierten Anstrengungen und die klaren Ziele treiben die Entwicklung in Richtung 'nützlicher' Ergebnisse. Die enge Verbindung zwischen Wissenschaft, Entwicklung, Technologie und (Start-up-)Unternehmen schafft dabei ein Umfeld, das den Transfer von der Grundlagenforschung zu Produkten viel stärker fördert. Andererseits kann es sehr hart sein, die 'Gewinner' auszuwählen und sie dann zu stoppen, wenn sie zu stocken scheinen.
In der österreichischen Quantenwissenschaft hat das grundlegende und tiefe Verständnis einen hohen Stellenwert. Auch wenn sich das Umfeld verändert, vor allem durch die große Zahl hervorragender Quanten-Start-ups, die in Österreich entstehen.
Was würden Sie sich für die transatlantische Zusammenarbeit wünschen?
Weniger Politik 😊
Jörg Schmiedmayer Bio
Jörg Schmiedmayer studierte Physik an der Technischen Universität Wien und Astronomie an der Universität Wien. Seine Diplomarbeit führte ihn an das CERN, wo er etwa ein Jahr lang an Experimenten arbeitete. Für seine Doktorarbeit in Experimentalphysik kehrte er nach Wien zurück und promovierte 1988 bei Helmut Rauch. Danach führte ihn die Wissenschaft für mehrere Jahre in die USA. Dort arbeitete er zunächst am Oak Ridge National Lab, dann als Postdoc und Gastwissenschaftler an der Harvard University und am MIT und wechselte von der Hochenergie- und Kernphysik zur Materiewelleninterferometrie und Quantenphysik.
1993 folgte er einer Einladung von A. Zeilnger an die Universität Innsbruck, wo er die Manipulation ultrakalter Atome mit nanofabrizierten Schaltkreisen entwickelte, die heute als AtomChips bekannt sind. Im Jahr 2000 nahm er eine Professur an der Universität Heidelberg an, wo seine Forschungsgruppe die AtomChips weiterentwickelte und sie für eine Reihe von Quantengasexperimenten einsetzte. In einem zweiten Forschungsprogramm entwickelte er zusammen mit seinem Postdoc (und damaligen Junior-Gruppenleiter) JianWei PAN die Wissenschaft, Ensembles von gefangenen ultrakalten Atomen als Atom-Photon-Hybridsysteme für Einzelphotonenquellen, Quantenkommunikationsprotokolle und Quantenrepeater einzusetzen. Im Jahr 2006 kehrte er an die TU-Wien zurück, wo er und seine Forschungsgruppe derzeit (i) Vielkörper-Quantensysteme als Quantensimulatoren für Quantenfeldtheorien und Quantenphysik außerhalb des Gleichgewichts sowie (ii) hybride Quantensysteme aus Spins, die an supraleitende Schaltkreise gekoppelt sind, untersuchen. Jörg Schmiedmayer erhielt unter anderem den Wittgenstein Preis (für AtomChip) und zwei ERC AdG. Er ist Vollmitglied der ÖAW und Vorstandsmitglied des Exzellenzclusters: Quantum Science Austria (quantA).