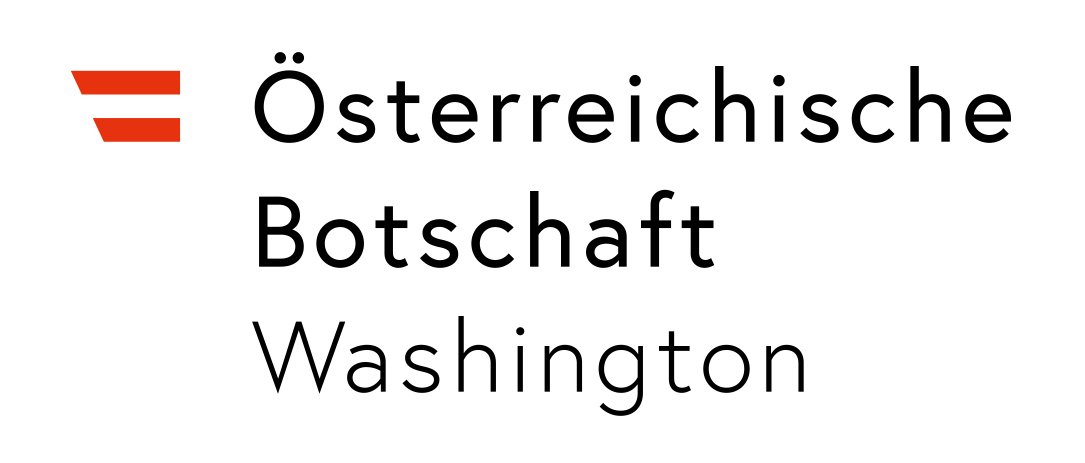Transatlantische Perspektiven: Tracy Northrup
Tracy Northrup
Sie sind nach Ihrem Doktoratsstudium in Kalifornien nach Innsbruck gezogen? Warum ausgerechnet Innsbruck? Wie war dieser Wechsel für Sie?
War es für Sie einfach, sich in Österreich zurechtzufinden und einzuleben? Was war einfach und wo hatten Sie Schwierigkeiten?
Ich war begeistert von der Forschung, die Rainer Blatt und seine Gruppe in Innsbruck mit gefangenen Ionen betrieben. Meine Doktorarbeit basierte auf Experimenten mit neutralen Atomen, und ich wollte weiter an der Quanteninformationsverarbeitung arbeiten, aber als Postdoc etwas Neues lernen. Außerdem war ich sehr neugierig auf gefangene Ionen. Einige der Dinge, die mit neutralen Atomen schwierig sind, werden mit Ionen einfach, und das war verlockend.
Als ich in meinem letzten Jahr als Doktorand nach Innsbruck kam, war ich beeindruckt von der Teamarbeit und dem Gemeinschaftssinn in Rainers Gruppe. Ich kam aus einer Forschungsgruppe, in der Wissenschaft ebenfalls als Teamarbeit angesehen wurde, und wusste daher aus Erfahrung, wie wichtig das ist. Es war auch beeindruckend, zu sehen, wie eng Theoretiker und Experimentatoren in Innsbruck zusammenarbeiteten.
Es war eine große Umstellung für mich, von Kalifornien nach Österreich zu ziehen! Aber es war auch sehr gesund und hat mir die Augen geöffnet, zu sehen, dass die Dinge ganz anders sein können, als ich es gewohnt war, sowohl in der Wissenschaft als auch im täglichen Leben. Für europäische Forscher ist es durchaus üblich, einen Postdoc im Ausland zu absolvieren. Amerikaner ziehen das oft nicht als Option in Betracht, was vielleicht schade ist. Ich bin jetzt seit fast 17 Jahren hier, aber damals ging ich davon aus, dass ich nur zwei oder drei Jahre bleiben würde. Zunächst fühlte es sich also nicht wie eine Sesshaftigkeit an, sondern eher wie eine Chance, meine Perspektive für ein paar Jahre zu erweitern.
Was zeichnet Ihrer Meinung nach die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Österreich und den USA heute aus, nicht nur, aber auch im Bereich der Quantenwissenschaften?
Jede Wissenschaft ist international, aber aus meiner Erfahrung in der Quantenwissenschaft kann ich sagen, dass es viele, viele Kooperationen zwischen Forschungsgruppen in verschiedenen Ländern gibt und dass die Forscher sehr genau wissen, woran ihre Kollegen auf der ganzen Welt arbeiten. Österreich ist zwar viel kleiner als die USA, aber in der Quantenwissenschaft übertrifft es sein Gewicht. Ich habe den Eindruck, dass die US-Wissenschaftler gut über den Stand der Forschung in Österreich informiert sind und andersherum. Oft gibt es Langzeitaufenthalte in beide Richtungen, z.B. ein amerikanischer Professor, der ein Sabbatical in Österreich macht, oder ein österreichischer Doktorand, der eine US-Gruppe für mehrere Monate besucht. Diese Art von persönlichen Verbindungen können dann zu gemeinsamen Arbeiten oder Forschungsprojekten führen.
Was sind die Stärken und Schwächen der Quantenwissenschaft in den USA und Österreich? Können sie sich gegenseitig ergänzen oder voneinander lernen?
Sowohl die USA als auch Österreich wissen die Bedeutung der Grundlagenforschung für die Innovation sehr zu schätzen. Es gibt viele strukturelle Unterschiede zwischen den beiden Ländern, z.B. in der öffentlich oder privat finanzierten Universitätsausbildung, in der Art und Weise, wie Förderprogramme gestaltet sind, in der Verfügbarkeit von Risikokapital für Start-ups und in der unterschiedlichen Mentalität, Risiken einzugehen. Sicherlich können sich diese Aspekte ergänzen, und es ist hilfreich zu sehen, welche Strategien in einem anderen Land funktionieren, und darüber nachzudenken, wie sie an das eigene Umfeld angepasst werden können. Insgesamt sehe ich jedoch viele Gemeinsamkeiten zwischen dem amerikanischen und dem österreichischen Ansatz in der Quantenwissenschaft.
Wie sehen Sie die Zukunft der Quantenforschung in Österreich? Wird es noch möglich sein, mit der Weltspitze mitzuhalten?
In den vergangenen Jahrzehnten haben die Forschungseinrichtungen und Förderorganisationen in Österreich die Quantenwissenschaft und -technologie entscheidend und nachhaltig unterstützt. Ich bin optimistisch, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird. Außerdem haben wir mit unserem österreichischen Exzellenzcluster eine solide Grundlage für österreichische Quantenforscher, die zusammenarbeiten und sich gegenseitig bei der Lösung anspruchsvoller Probleme unterstützen. Ich mache mir also keine Sorgen, hinter andere Länder zurückzufallen.
Vor fünfzehn Jahren war die Quantenforschung ein akademisches Unterfangen. Heute dagegen gibt es so viele verschiedene Bereiche, in denen Menschen große Fortschritte machen: Universitäten, aber auch Start-ups und große etablierte Unternehmen. Das bedeutet, dass wir - und damit meine ich alle, die weltweit an diesen Problemen arbeiten - sorgfältig überlegen müssen, wo wir einen sinnvollen Beitrag leisten können. Es gibt bestimmte Probleme, die Unternehmen besser lösen können, wie z.B. die Herstellung von Quantencomputer-Hardware, und die Universitäten werden nicht unbedingt in der Lage sein, bei diesen Problemen mitzuhalten. Aber es gibt auch andere Probleme, wie z.B. hochriskante Fragen im Frühstadium, die sich gut für akademische Gruppen eignen.
Leider gibt es immer noch viel mehr männliche als weibliche Quantenforscher. Woran liegt das und was können wir tun, um mehr Frauen in dieses spannende Forschungsgebiet zu bringen?
Es kann verlockend sein, diese Frage mit Anekdoten aus persönlicher Erfahrung zu beantworten. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es Experten gibt, die diese Fragen untersuchen: Wie viel von der Kluft zwischen den Geschlechtern hängt mit den prägenden Erfahrungen in der Grundschule oder der High School zusammen? Wie viel spielt sich auf der Hochschulebene ab? Wie viel passiert später in der beruflichen Laufbahn? Und dann ist es unsere Aufgabe als Physiker, auf diese Experten zu hören und zu verstehen, was sie herausgefunden haben und welche Schritte die größte Wirkung haben werden.
Es gibt so viel spannende Arbeit an der Spitze der Quantenwissenschaft zu tun. Wir brauchen alle Talente, die wir bekommen können, und das bedeutet, dass wir aus einem vielfältigen Talentpool schöpfen müssen. Im Rahmen des Internationalen Jahres der Quantenwissenschaft und -technologie gibt es wunderbare Bemühungen, die Menschen zu erreichen. Ich hoffe, dass diese Bemühungen Menschen inspirieren werden, die dies sonst vielleicht nicht als Karriereweg in Betracht ziehen würden, insbesondere junge Mädchen, um zu sehen, wie lohnend es sein kann, die Quantenwelt zu studieren.
Tracy Northup Bio
Tracy Northup ist Professorin für Experimentalphysik an der Universität Innsbruck, Österreich. Ihre Forschung beschäftigt sich mit Quantenschnittstellen zwischen Licht und Materie, wobei sie sich auf gefangene Ionen und auf Hohlräumen basierende Schnittstellen für Quantennetzwerke und Quantenoptomechanik konzentriert. Sie promovierte 2008 am California Institute of Technology und war anschließend als Postdoktorandin an der Universität Innsbruck tätig, wo sie ein Marie Curie International Incoming Fellowship und ein Elise Richter Fellowship erhielt. Im Jahr 2015 wurde sie Assistenzprofessorin an der Universität Innsbruck und ist seit 2017 ordentliche Professorin; von 2017 bis 2022 hatte sie eine Ingeborg-Hochmair-Professur inne. Im Jahr 2016 erhielt sie den START-Preis, die höchste österreichische Auszeichnung für junge Wissenschaftler, vom Österreichischen Wissenschaftsfonds. Im Jahr 2023 erhielt sie die Gordon Memorial Speakership von Optica.