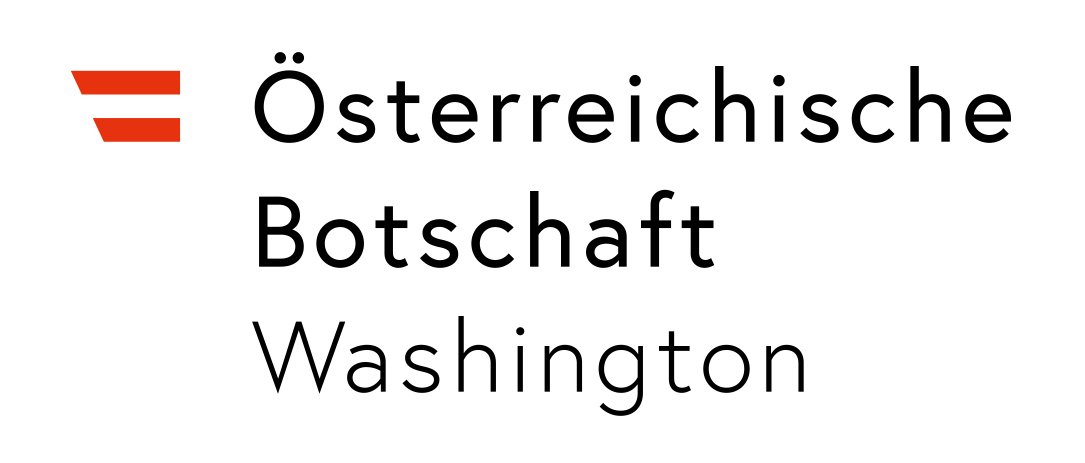Die religiöse Landschaft Österreichs
RECHTSGRUNDLAGE - PERSÖNLICHKEITSRECHTE
Die Religionsfreiheit ist in Österreich ein gesetzlich garantiertes Recht, dessen gesetzliche Grundlagen - beginnend mit den Toleranzpatenten von 1781/82 - in einem Zeitraum von rund zwei Jahrhunderten geschaffen wurden. Von großer Bedeutung für den Einzelnen ist die verfassungsrechtliche Garantie der Gewissens- und Bekenntnisfreiheit, die in Artikel 14 des Grundgesetzes über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger von 1867 verankert ist. Dieser Artikel garantiert in Verbindung mit dem Gesetz über die konfessionellen Beziehungen von 1868 jedem in Österreich wohnhaften Menschen das Recht, sich nach freier Wahl einer Kirche oder Religionsgemeinschaft anzuschließen, aus einer solchen nach eigenem Ermessen auszutreten oder sich schließlich der Zugehörigkeit zu einer solchen zu enthalten. Artikel 63 Absatz 2 des Staatsvertrages von Saint-Germain-en-Laye aus dem Jahr 1919 sowie Artikel 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention aus dem Jahr 1950 haben das Grundrecht der Religionsfreiheit weiter ausgebaut und präzisiert.
EINBEZIEHUNGSRECHTE
Die österreichische Rechtsordnung ist von ihrer Konzeption her als religiös neutral zu qualifizieren. Dieser Grundsatz schließt jede Identifikation des Staates mit einer bestimmten Kirche oder Religionsgemeinschaft aus (Grundsatz der religiösen Neutralität). Die Aufgaben und Ziele des Staates sind ausschließlich weltlich und nicht geistlich (Grundsatz der Säkularität).
Der Status einer rechtlich anerkannten Kirche und Religionsgemeinschaft ist mit bestimmten Garantien verbunden, die in Artikel 15 des Grundgesetzes über die allgemeinen Rechte der Staatsangehörigen (das auch ihre Unterwerfung unter die allgemeinen Gesetze des Staates postuliert) festgelegt sind: das Recht, gemeinsam öffentliche Gottesdienste abzuhalten, ihre "inneren" Angelegenheiten selbständig zu regeln und zu verwalten und den Besitz und die Verfügung über ihre Einrichtungen, Stiftungen und Gelder zu behalten; außerdem das Recht, private konfessionelle Lehr- und Erziehungsanstalten zu gründen und Religionsunterricht an staatlichen Schulen zu erteilen.
Artikel 15 des Grundgesetzes über die allgemeinen Rechte der Staatsangehörigen konkretisiert den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz und postuliert das Gebot der Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung (Grundsatz der Parität).
Das Ausschließlichkeitsrecht als Grundprinzip des österreichischen Staatskirchenrechts garantiert jeder gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgemeinschaft das ausschließliche Recht auf ihre Bezeichnung und ihre Lehren sowie die ausschließliche seelsorgerische Verantwortung für ihre Mitglieder.
In Österreich sind Staat und Kirche gleichberechtigte Partner, die die Eigenständigkeit und Autonomie des jeweils anderen anerkennen. Bereiche des Zusammenwirkens können u.a. durch gegenseitige vertragliche Vereinbarungen geregelt werden. Die rechtliche Anerkennung bedeutet die Anerkennung einer Kirche oder Religionsgemeinschaft als Rechtspersönlichkeit des öffentlichen Rechts, die ihr den Status einer juristischen Person des öffentlichen Rechts (einschließlich der Rechtsfähigkeit im Privatrecht) verleiht.
Ein Merkmal solcher Einrichtungen ist die Wahrnehmung von Aufgaben und Funktionen im öffentlichen Interesse, zu denen neben religiösen auch soziale, gesellschaftspolitische und kulturelle Aufgaben gehören, die vom Staat unterstützt werden, da er sie als Beitrag zum Gemeinwohl betrachtet. Die Grundsätze für das Verhältnis zwischen Staat und Kirche wurden in verschiedenen Erlassen festgelegt. Das Verhältnis zur katholischen Kirche wird vor allem durch das Konkordat von 1933 und eine Reihe von weiteren Gesetzen, die das Verhältnis zwischen dem österreichischen Staat und dem Heiligen Stuhl in verschiedenen Bereichen regeln, festgelegt. Die römisch-katholische Kirche genießt insofern besondere Rechte, als der Heilige Stuhl dem Völkerrecht unterworfen ist.
Gesetzliche Erlasse regeln auch das Verhältnis des Staates zu anderen Kirchen und Religionsgemeinschaften: die Evangelische Kirche im Protestantengesetz von 1961, die Orthodoxe Kirche im Orthodoxengesetz von 1967, die Israelitische Religionsgesellschaft im Israelitengesetz von 1890 und die Islamische Religionsgemeinschaft im Islamgesetz von 1912 in der Fassung von 2015. Das Verhältnis zu den anderen gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften ist auf der Grundlage des Anerkennungsgesetzes von 1874 und des Orientalisch-Orthodoxen Kirchengesetzes von 2003 geregelt.
Mit der Verabschiedung des Bundesgesetzes über die Rechtsstellung der Bekenntnisgemeinschaften im Jahr 1998 wurde ein zweistufiges System geschaffen. Neben den gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften dürfen Konfessionsgemeinschaften, die keine Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, aber mit einer Rechtspersönlichkeit ausgestattet sind, die Bezeichnung "staatlich anerkannte Konfessionsgemeinschaft" führen. Die rechtliche Anerkennung als Religionsgemeinschaft kann bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen nach zwanzigjährigem Bestehen und zehnjähriger Eintragung als Bekenntnisgemeinschaft erteilt werden.
Heute gibt es in Österreich 16 gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgemeinschaften und 10 staatlich registrierte Bekenntnisgemeinschaften.
AUSDRÜCKE DES GRUNDRECHTS DER RELIGIONSFREIHEIT
Der Begriff der Religionsfreiheit umfasst die Freiheit des Glaubensbekenntnisses (Recht auf freie Wahl der Religion), die Freiheit des öffentlichen Gottesdienstes (Recht auf Religionsausübung), die Bekenntnisfreiheit (Recht auf äußeres Bekenntnis des Glaubens) und die Gewissensfreiheit.
Nach österreichischem Recht (Gesetz über die religiöse Erziehung von Kindern) steht es jedem Jugendlichen über vierzehn Jahren frei, seine Religion zu wählen. Bis zum Alter von zehn Jahren haben die Eltern das alleinige Recht, über das Bekenntnis ihres Kindes zu entscheiden. Zwischen dem zehnten und zwölften Lebensjahr liegt die Entscheidung immer noch bei den Eltern, aber das Kind muss "angehört" werden.
Zwischen dem zwölften und vierzehnten Lebensjahr kann dem Kind ein Konfessionswechsel nicht gegen seinen Willen aufgezwungen werden, und mit Vollendung des vierzehnten Lebensjahres wird der Jugendliche "mündig" in Bezug auf die Wahl der Religion. In staatlichen Schulen erhalten alle Kinder, die einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgemeinschaft angehören, Religionsunterricht in ihrem eigenen Bekenntnis, wobei die Kosten für diesen Unterricht vom Staat getragen werden.
In Österreich sind alle Bürgerinnen und Bürger vor dem Gesetz gleich und genießen unabhängig von ihrem Bekenntnis die gleichen bürgerlichen und politischen Rechte. Die freie Religionsausübung sowie die Religions- und Wissenschaftsfreiheit sind für alle Menschen in Österreich gewährleistet, unabhängig davon, ob eine Kirche oder Religionsgemeinschaft gesetzlich anerkannt oder nicht anerkannt oder als Bekenntnisgemeinschaft registriert ist. Alle Kirchen und Religionsgemeinschaften in Österreich genießen einen besonderen gesetzlichen Schutz: Straftaten wie die Verunglimpfung religiöser Lehren und die Störung einer religiösen Veranstaltung werden strafrechtlich verfolgt; Einrichtungen und Gegenstände, die religiösen Zwecken dienen, genießen bei Diebstahl oder mutwilliger Beschädigung einen erhöhten strafrechtlichen Schutz.
DIALOGFOREN
Von besonderer Bedeutung für die Präsenz der christlichen Kirchen im öffentlichen Leben Österreichs und über die Landesgrenzen hinaus ist der "Ökumenische Rat der Kirchen in Österreich" (ÖRKÖ, http://oekumene.at), dem 14 christliche Kirchen angehören, darunter seit 1994 auch die römisch-katholische Kirche und zehn Gemeinschaften und Organisationen mit Beobachterstatus.
Weiters ist die Stiftung Pro Oriente (www.prooriente.at) zu erwähnen, die seit 1964 eine Plattform für kontinuierliche und fruchtbare Gespräche mit den orthodoxen und orientalisch-orthodoxen Kirchen darstellt. Ihre Gründung ist maßgeblich auf die Kontakte des langjährigen Wiener Erzbischofs Kardinal Franz König zu den Ostkirchen zurückzuführen. Außenpolitische Initiativen auf der Balkanhalbinsel wurden immer wieder von dieser Plattform unterstützt. Der interreligiöse Dialog findet über die "Kontaktstelle für Weltreligionen in Österreich" (www.weltreligionen.at) statt, die sich auch als Forum für die Förderung der Beziehungen zwischen den Religionen versteht.
Religionen in Österreich
Am Ende des 20. Jahrhunderts waren etwa 74 % der österreichischen Bevölkerung als römisch-katholisch registriert, während sich etwa 5 % als Protestanten bezeichneten. In den letzten Jahrzehnten ist der Katholizismus in Österreich allmählich zurückgegangen. Im Dezember 2021 lag die Zahl der Katholiken in Österreich bei 4,93 Millionen (55 %) und die Zahl der Protestanten bei 340.300 (3,8 %).
Die österreichischen Christen sind verpflichtet, einen Pflichtbeitrag (berechnet nach dem Einkommen - ca. 1 %) an ihre Kirche zu zahlen; diese Zahlung wird "Kirchenbeitrag" genannt. Im Jahr 2021 erklärten etwa 22,4 % der Bevölkerung, dass sie keiner Religion angehören. Von den verbleibenden Menschen sind etwa 745.600 als Mitglieder verschiedener muslimischer Gemeinschaften registriert, was hauptsächlich auf den Zustrom aus der Türkei, Bosnien-Herzegowina und dem Kosovo zurückzuführen ist. Etwa 437.700 sind Mitglieder östlich-orthodoxer Kirchen (meist Serben), mehr als 20.000 sind aktive Zeugen Jehovas, und etwa 8.100 sind Juden.
Die österreichische jüdische Gemeinde von 1938 - allein in Wien gab es mehr als 200.000 - wurde während des Zweiten Weltkriegs auf etwa 4.500 reduziert, wobei etwa 65.000 jüdische Österreicher im Holocaust getötet wurden und 130.000 emigrierten. Die große Mehrheit der heutigen jüdischen Bevölkerung sind Nachkriegseinwanderer, vor allem aus Osteuropa und Zentralasien (einschließlich bucharischer Juden). Der Buddhismus wurde 1983 in Österreich gesetzlich als Religion anerkannt.
ÜBERSICHT DER GESETZLICH ANERKANNTEN KIRCHEN UND RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN IN ÖSTERREICH KIRCHEN
Religionsgemeinschaften durch gesonderten Rechtsakt:
Katholische Kirche: Grundsätzlich Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Österreich, BGBl. II Nr. 2/1934
Evangelische Kirche A.C. und H.C. in Österreich: Evangelisches Gesetz, 1961, BGBl. Nr. 182/1961
Griechisch-Orientalische (d.h. griechisch-orthodoxe) Kirche in Österreich: Orthodoxengesetz, 1967, Bundesgesetzblatt (BGBl.) Nr. 229/1967
Orthodoxe Bischofskonferenz
Griechisch-Orientalische Metropole Österreichs
Griechisch-orientalische (d.h. griechisch-orthodoxe) Kirchengemeinschaft der Heiligen Dreifaltigkeit
Griechisch-Orientalische (d.h. griechisch-orthodoxe) Kirchengemeinde St. Georg
Antiochenisch-Orthodoxe Kirchengemeinde St. Peter und Paul
Russisch-Orthodoxe Diözese von Wien und Österreich
Russisch-Orthodoxe Kirchengemeinde St. Nicolas
Serbisch-Griechisch-Orientalische (d.h. Serbisch-Orthodoxe) Kirchengemeinde St. Sava
Rumänisch-Griechisch-Orientalische (d.h. rumänisch-orthodoxe) Kirchengemeinschaft der Heiligen Auferstehung
Russisch-Orthodoxe Kirchengemeinde St. Nicolas
Bulgarisch-Orthodoxe Kirchengemeinde St. Ivan Rilski
Jüdische Religionsgesellschaft: Judengesetz 1890, RGBl. Nr. 57/1890 in der Fassung des BGBl. Nr. 61/1984
Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich: Islamgesetz von 2015, BGBl. Nr. I 39/2015
Alevitische Religionsgemeinschaft in Österreich, Islamgesetz von 2015, BGBl. Nr. I 39/2015
Kirchen, die dem Orientalisch-Orthodoxen Kirchengesetz von 2003, BGBl. Nr. 20/2003, unterliegen:
Armenisch-Apostolische Kirche in Österreich
Syrisch-Orthodoxe Kirche in Österreich
Koptisch-Orthodoxe Kirche in Österreich
Basierend auf dem Anerkennungsgesetz von 1874, RGBI. Nr. 68/1874:
Altkatholische Kirche Österreichs, Reichsgesetzblatt (RGBI.) Nr. 99/1877
Methodistische Kirche in Österreich, BGBl. Nr. 74/1951 in der Fassung des BGBl. II Nr. 190/2004
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen) in Österreich, Bundesgesetzblatt (BGBl.) Nr. 229/1955
Neuapostolische Kirche in Österreich, Bundesgesetzblatt (BGBl.) Nr. 524/1975
Österreichischer Buddhistischer Religionsverband, BGBl. Nr. 72/1983
Zeugen Jehovas in Österreich, Bundesgesetzblatt (BGBl.) II Nr. 139/2009
"Freikirchen in Österreich", Bundesgesetzblatt (BGBl.) Nr. II 250/2013
Geschichte
Während Nord- und Mitteldeutschland der Ursprung der Reformation war, bildeten Österreich und Bayern das Zentrum der Gegenreformation im 16. und 17. Jahrhundert, als die absolute Monarchie der Habsburger ein strenges Regime durchsetzte, um die Macht und den Einfluss des Katholizismus unter den Österreichern wiederherzustellen.
Lange Zeit sahen sich die Habsburger als Vorhut des Katholizismus, alle anderen Konfessionen und Religionen wurden unterdrückt. Im Jahr 1781, im Zeitalter der österreichischen Aufklärung, erließ Kaiser Joseph II. ein Toleranzpatent für Österreich, das anderen Konfessionen eine begrenzte Religionsfreiheit einräumte. Nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich 1867 wurde die Religionsfreiheit in Cisleithanien zum Verfassungsrecht erklärt, womit der Tatsache Rechnung getragen wurde, dass in der Monarchie neben dem römischen Katholizismus zahlreiche andere Religionen beheimatet waren, darunter griechische, serbische, rumänische, russische und bulgarisch-orthodoxe Christen (Österreich war jahrhundertelang Nachbar des Osmanischen Reiches), Calvinisten, lutherische Protestanten und Juden. Nach der Annexion von Bosnien-Herzegowina im Jahr 1908 wurde der Islam 1912 in Österreich offiziell anerkannt. Österreich ist nach wie vor stark vom Katholizismus geprägt. Der Katholizismus wurde von Engelbert Dollfuß und Kurt Schuschnigg fast wie eine Staatsreligion behandelt.
Obwohl katholische (und protestantische) Führer die Deutschen 1938 beim Anschluss Österreichs an Deutschland zunächst willkommen hießen, stellte der österreichische Katholizismus später seine Unterstützung für den Nationalsozialismus ein, und viele ehemalige religiöse Persönlichkeiten engagierten sich während des Dritten Reichs im Widerstand. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945 wurde in Österreich ein strengerer Laizismus eingeführt, und der religiöse Einfluss auf die Politik ging zurück. Der österreichische Staat garantiert den gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften die folgenden Rechte:
ÖFFENTLICHER GOTTESDIENST
Ausschließlichkeit (rechtlicher Schutz des Namens, ausschließliche pastorale Verantwortung für die Mitglieder)
Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts
Autonome Organisation und Verwaltung der "internen" Angelegenheiten
Schutz von Institutionen, Stiftungen und Fonds vor Säkularisierung
Einrichtung von konfessionellen Privatschulen
Erteilung von Religionsunterricht an öffentlichen Schulen
Derzeit sind in Österreich 13 Kirchen und Religionsgemeinschaften gesetzlich anerkannt. Die rechtliche Anerkennung macht eine Kirche oder Religionsgemeinschaft zu einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, die die Stellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts hat.
(Quelle: Bundeskanzleramt Österreich, Religion in Österreich 2021).