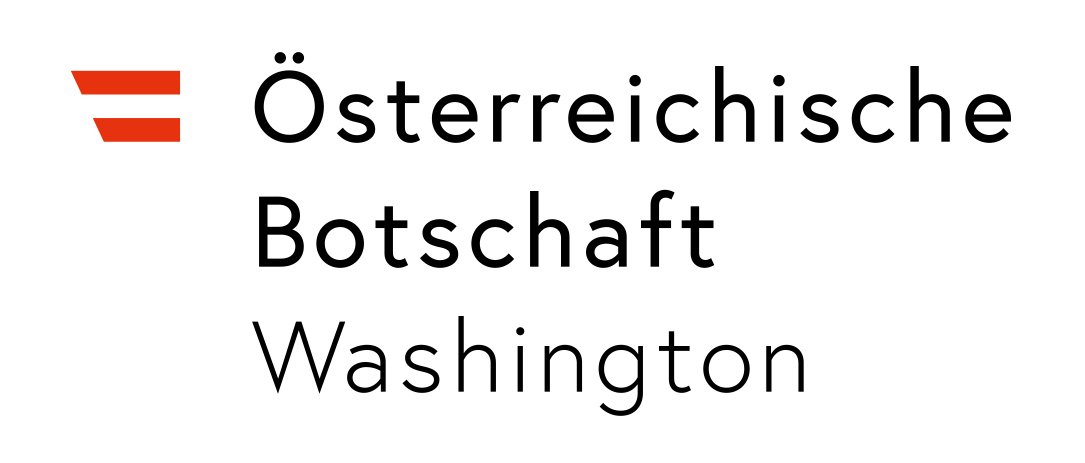Einführung
Diese Seite bietet einen Überblick über die diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich und den Vereinigten Staaten anlässlich des 180-jährigen Bestehens dieser bilateralen Beziehung.
Die hier präsentierten Materialien stammen vom Österreichischen Presse- und Informationsdienst in den Vereinigten Staaten, von der US-Botschaft in Wien (produziert aus Anlass des 175-jährigen Bestehens der diplomatischen Beziehungen) sowie von unserer Publikation Austrian Information und ihren einzelnen Autoren.
Dieses Video, das von der US-Botschaft in Wien aus Anlass des 175-jährigen Bestehens der diplomatischen Beziehungen produziert wurde, gibt einen Überblick über die österreichisch-amerikanischen Beziehungen:
Die Anfänge der Beziehung: Handel und Gewerbe
von der U.S. Botschaft Wien
Obwohl die offiziellen diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Österreich im Jahr 1838 aufgenommen wurden, begann die Beziehung zwischen den beiden Ländern bereits Jahrzehnte früher mit dem Interesse des österreichischen Kaiserreichs an der Erkundung von Handelsmöglichkeiten in der Neuen Welt. Wie die Geschichte zeigt, entwickelten sich die Beziehungen nicht immer harmonisch. Noch wichtiger ist jedoch, dass sie sich weiterentwickelt haben, um Hindernisse von historischer Tragweite zu überwinden. Heute, 180 Jahre später, sind die beiden Länder in ihrem Streben nach gemeinsamen Zielen für eine sichere und gerechte Welt eng miteinander verbunden.
Fotos: Kaiser Franz I. von Österreich und Andrew Jackson, Präsident der Vereinigten Staaten (1829- 1837)
Im Jahr 1777 ernannte der Kongress William Lee zum ersten Vertreter der USA in Wien. Österreich empfing ihn jedoch nicht, da es sich weigerte, ein Land anzuerkennen, das gegen eine Monarchie rebelliert hatte. In den Akten der Hofkanzlei wurden die amerikanischen Beamten als "Rebellen" und "Aufständische" bezeichnet. Dennoch betrieb das Reich während der Amerikanischen Revolution Waffenhandel mit den Kolonien und verfolgte Handelsinteressen auf den Baumwoll- und Tabakmärkten. Diese Zweideutigkeit kennzeichnete die Haltung des Kaiserreichs gegenüber den USA bis zum Ende des 19.
Offizielle diplomatische Beziehungen wurden jedoch mit der Ernennung von Henry A. Muhlenberg zum ersten amerikanischen Minister in Wien am 8. Februar 1838 aufgenommen. Er legte sein Beglaubigungsschreiben am 7. November 1838 vor. Der erste Minister des Österreichischen Kaiserreichs in den Vereinigten Staaten, Wenzel Philipp Baron de Mareschal, errichtete eine österreichische Gesandtschaft in Washington, D.C., und überreichte am 13. Oktober 1838 sein Beglaubigungsschreiben.
Bis 1850 hatte Österreich 11 Honorarkonsularbüros eingerichtet, vor allem an der Golf- und Atlantikküste, die sich hauptsächlich auf den Handel mit Tabak und Baumwolle konzentrierten. Im Laufe der Zeit und trotz zweier Weltkriege bauten die USA und Österreich Handelsbeziehungen auf und aus, die bis heute florieren. Die USA sind der drittgrößte Investor in Österreich. Für US-amerikanische Unternehmen ist Österreich ein attraktiver und wohlhabender Exportmarkt. Amerikanische Unternehmen haben mehr als 20 Milliarden Dollar in Österreich investiert und beschäftigen heute mehr als 30.000 Österreicher; 130 österreichische Unternehmen haben mehr als 6,9 Milliarden Dollar in den USA investiert und beschäftigen 25.000 Amerikaner. Für die USA und Österreich sind Handel und Investitionen eine dynamische, ständig wachsende Zweibahnstraße.
Aufbau der Beziehung: Einwanderung
Im Jahr 1734 unternahmen fünfzig Familien von Exil-Lutheranern aus Salzburg eine zweimonatige Reise über den Atlantik und gründeten eine Gemeinde in Ebenezer, Georgia. Diese Salzburger und ihre Nachkommen haben eine wichtige Rolle in der Geschichte des Bundesstaates Georgia und der USA gespielt. Sie gehörten zu den ersten Siedlern in Amerika, die sich gegen die Sklaverei aussprachen, und sie zeichneten sich durch ihre Dienste und Beiträge zum wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und politischen Leben in Amerika aus. Die Einwanderung aus Österreich-Ungarn setzte sich im 19. Jahrhundert fort und erreichte ihren Höhepunkt im ersten Jahrzehnt des 20.
Aufgrund des Status Österreichs als multiethnisches Reich ist es schwierig, die tatsächliche Zahl der österreichischen Einwanderer in die Vereinigten Staaten vor 1918 zu bestimmen. Aufzeichnungen zeigen jedoch, dass mehr als 2,1 Millionen Einwanderer aus den Ländern der österreichisch-ungarischen Monarchie in die USA kamen - die größte Gruppe aller Einwanderer in dieser Zeit. Von den ersten österreichischen Siedlern in Georgia bis zu den großen Einwanderungswellen im 19. und frühen 20. Jahrhundert war das Hochseeschiff das wichtigste Transportmittel. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts schloss sich eine österreichische Reederei, die Austro-Americana , dem Zug von Europa nach Amerika und zurück an
Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs kam die österreichische Einwanderung praktisch zum Erliegen. In der Nachkriegszeit von 1919 bis 1924 kamen weniger als 20.000 Österreicher in die Vereinigten Staaten, von denen schätzungsweise 60 % aus dem Burgenland stammten. Laut der US-Volkszählung bekennen sich 735.128 Amerikaner zu ihrer österreichischen Herkunft. Sie leben hauptsächlich in New York, Kalifornien, Pennsylvania, Florida, Illinois und New Jersey. Wie ihre Vorfahren bereichern auch sie die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Österreich.
Die Beziehung zu einer neuen Republik: Der Erste Weltkrieg und die Zwischenkriegsjahre
In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg verfolgten die USA eine Politik der Konfliktvermeidung und versuchten, Frieden zu vermitteln. Trotz dieser Bemühungen trat Präsident Woodrow Wilson am 2. April 1917 vor eine Sondersitzung des Kongresses, um seine "Kriegsbotschaft" zu verkünden und eine Kriegserklärung gegen Deutschland zu beantragen, da Deutschland seine Zusage, den uneingeschränkten U-Boot-Krieg auszusetzen, nicht eingehalten hatte. Vier Tage später verabschiedete der Kongress mit überwältigender Mehrheit die Kriegsresolution. Österreich-Ungarn brach daraufhin am 8. April 1917 die diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten ab. Acht Monate später, am 7. Dezember 1917, erklärten die Vereinigten Staaten Österreich-Ungarn den Krieg.
Am 8. Januar 1918 legte Wilson dem Kongress seine historischen "Vierzehn Punkte" vor, die den Rahmen für eine Weltordnung nach dem Krieg bildeten. Der zehnte Punkt forderte die "freieste Möglichkeit zur autonomen Entwicklung" der Völker Österreich-Ungarns und trug damit zur Auflösung des Reiches bei. Im Gegensatz zu ihren Verbündeten ratifizierten die USA den Vertrag von St. Germain am 10. September 1919 nicht, weil er den Völkerbundvertrag enthielt, ein Konzept, das der US-Kongress zu diesem Zeitpunkt nicht unterstützen wollte. Stattdessen unterzeichneten die Vereinigten Staaten den Vertrag zur Herstellung freundschaftlicher Beziehungen und erkannten die Republik Österreich am 24. August 1921 an.
In den 1930er Jahren beeinflusste die Kombination aus der Weltwirtschaftskrise und der Erinnerung an die tragischen Verluste im Ersten Weltkrieg die amerikanische Politik, sich nicht in die internationale Politik einzumischen. Während der Aufstieg des Faschismus als Bedrohung für den Weltfrieden wahrgenommen wurde, hielt die wirtschaftliche Depression die Amerikaner in ihrem Handeln zurück.
Im März 1938 berichtete der U.S. Chargé d'Affaires ad interim John C. Wiley aus Wien, dass sich "die Visastelle in einem Belagerungszustand befindet". Zwischen der Annexion Österreichs durch Nazi-Deutschland 1938 und dem Kriegseintritt der USA 1941 emigrierten 29.000 Österreicher in die USA. Etwa 80 Prozent von ihnen waren Juden: Fachleute und Intellektuelle, darunter Ärzte, Rechtsanwälte, Architekten, Wissenschaftler, Musiker und Komponisten sowie Film- und Bühnenkünstler. In den USA fanden sie die Möglichkeit, weiterhin bedeutende Beiträge zur Weltkultur zu leisten, die der Gesellschaft heute zugute kommen.
1940 ging die US-Politik von der Neutralität zur Kriegsfreiheit über, indem sie den Nationen, die sich im Krieg mit Deutschland, Italien und Japan befanden, Hilfe leistete. Am 7. Dezember 1941 griffen die Japaner die US-Marineeinrichtungen in Pearl Harbor an, wodurch die Vereinigten Staaten formell in den Zweiten Weltkrieg eintraten. Auch wenn dies bedeutete, dass die Beziehungen zu Österreich erneut abgebrochen wurden, boten die Nachkriegsjahre dennoch politische und wirtschaftliche Möglichkeiten, die die Beziehungen zwischen den USA und Österreich neu definierten. Trotz einiger Kontroversen und Meinungsverschiedenheiten, wie der "Waldheim-Affäre" von 1986, haben die Vereinigten Staaten und Österreich die Grundlage für ein gemeinsames Engagement für humanitäre Werte und demokratische Institutionen geschaffen, die die heutige Gesellschaft beeinflussen.
Eine neue Beziehung aufbauen
Im langfristigen Interesse der Vermeidung eines weiteren globalen Krieges setzten die USA zum ersten Mal Wirtschaftshilfe als strategisches Element ihrer Außenpolitik ein und boten Europa umfangreiche Hilfe an. Bis Juni 1947, als die UN Relief and Rehabilitation Administration die Lebensmittellieferungen an Österreich einstellte, hatten die USA 300 Millionen Dollar an Nahrungsmittelhilfe ausgegeben, um eine Hungerkrise abzuwenden.
Am 3. April 1948 unterzeichnete Präsident Harry S. Truman den Economic Cooperation Act, der die Einrichtung des European Recovery Program (ERP) genehmigte, das später als "Marshall-Plan" bekannt wurde. Die österreichische Regierung nahm das Angebot zur Teilnahme an, und am 2. Juli 1948 wurde ein bilaterales Abkommen unterzeichnet. Die US-Regierung finanzierte die Lieferung von Nahrungsmitteln, Maschinen und Rohstoffen an Österreich. Die Marshallplan-Hilfe für Österreich belief sich von Juli 1948 bis Dezember 1953 auf insgesamt 962 Millionen Dollar, womit Österreich nach Norwegen der größte Pro-Kopf-Empfänger von ERP-Hilfe war. Parallel zum ERP wurden in ganz Österreich Amerika Häuser errichtet, die als Bibliotheken, Konzertsäle und Kinos dienten, um die kulturellen Beziehungen und gemeinsamen Werte zwischen Österreichern und Amerikanern aufzubauen und zu stärken.
Am 29. März 1961 unterzeichneten der österreichische Bundeskanzler Julius Raab und der US-Botschafter H. Freeman Matthews das "ERP Counterpart Settlement Agreement", mit dem die Kontrolle über den ERP-Fonds an die österreichische Regierung übertragen wurde. Mit einem Vermögen von rund 3,5 Milliarden Dollar und jährlichen Darlehen in Höhe von 356 Millionen Dollar ist der ERP-Fonds bis heute in Betrieb und bleibt eines der wichtigsten und dynamischsten Instrumente der österreichischen Struktur- und Wirtschaftspolitik. Im Juni 2007 wurde in Erinnerung an den 60. Jahrestag der historischen Rede von George Marshall die Marshall Plan Foundation gegründet, um den Bildungsaustausch zwischen Amerikanern und Österreichern zu fördern.
Als Teil des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg bot der Fulbright Act (1946) wirtschaftliche Unterstützung für Bildung und Forschung und legte den Grundstein für das renommierte akademische Austauschprogramm der Vereinigten Staaten. Im Jahr 1950 gehörte Österreich zu den ersten wenigen Ländern, die eine binationale Fulbright-Kommission einrichteten. Dieses Vorzeigeprogramm der USA für den akademischen Austausch wurde von Senator J. William Fulbright ins Leben gerufen, um: "das gegenseitige Verständnis zwischen den Menschen in den Vereinigten Staaten und den Menschen in anderen Ländern zu verbessern ... und so die Entwicklung freundschaftlicher, wohlwollender und friedlicher Beziehungen zu unterstützen." Seit 1951 haben mehr als 2.300 amerikanische und 3.500 österreichische Stipendiaten am Fulbright-Programm teilgenommen. Seit 1963 wird es von Österreich mitfinanziert. Die Fulbright-Kommission hat mehr als 2.800 US-Hochschulabsolventen im Rahmen des Fremdsprachenassistentenprogramms des österreichischen Unterrichtsministeriums an weiterführende Schulen in ganz Österreich vermittelt.
Der österreichisch-amerikanische Austausch hat seit dem Zweiten Weltkrieg stetig zugenommen. IES Abroad, der größte Vermittler von Auslandsstudienprogrammen für US-Studenten, wurde 1950 am Institut für Europäische Studien in Wien gegründet. Jedes Jahr studieren etwa 1.000 Österreicher an Universitäten in den USA, und etwa 2.700 Amerikaner studieren im Rahmen von Programmen, die von österreichischen und amerikanischen Bildungseinrichtungen entwickelt wurden, in Österreich.
In den letzten 60 Jahren wurden mehr als 1.000 Österreicher zur Teilnahme am International Visitor Leadership Program (IVLP), dem wichtigsten beruflichen Austauschprogramm des US-Außenministeriums, eingeladen. Durch kurzfristige Besuche in den Vereinigten Staaten können aktuelle und aufstrebende Führungskräfte aus einer Vielzahl von Fachgebieten die amerikanische Kultur und Gesellschaft aus erster Hand erleben und dauerhafte Beziehungen zu ihren amerikanischen Kollegen aufbauen.
Österreichisch-amerikanische Beziehungen vom Kalten Krieg bis zur Nachkriegszeit
von Günter Bischof
Während des Kalten Krieges war Österreich eine Art "Liebling" der Supermächte und sah sich in einer "besonderen Rolle" (Sonderfall). Als neutraler Staat im Kalten Krieg spielte es eine entscheidende Rolle als Vermittler und "Brückenbauer" zwischen Ost und West. Wien war Schauplatz wichtiger Gipfeltreffen (Kennedy-Chruschtschow 1961, Carter-Brezhnev 1979) und langjähriger Rüstungskontrollkonferenzen (Conventional Force Reduction Talks) sowie dritter Sitz (neben New York und Genf) wichtiger UN-Organisationen wie der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA). Österreich war ein wichtiger Akteur unter den neutralen und blockfreien Staaten bei der Vorbereitung und Durchführung der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die 1975 in Helsinki ihren Höhepunkt fand und die europäische Entspannung zementierte, sowie bei deren Folgetreffen. Politisch respektiert Washington die österreichische Neutralität, seit Außenminister und damaliger Bundeskanzler Bruno Kreisky nach der Unterzeichnung des Staatsvertrags 1955 seine "aktive Neutralitätspolitik" als sehr prowestlich definierte.
Wirtschaftlich profitierte Österreich weiterhin von den aus dem Marshallplan übrig gebliebenen Gegenwertmitteln. 1961 übergab die amerikanische Regierung das gesamte Gegenwertkonto an die Regierung Julius Raab, die den ERP-Fonds" als wichtiges dauerhaftes, langfristiges und zinsgünstiges Anlageinstrument für die österreichische Wirtschaft initiierte. Die Österreicher empfanden ihren Status als "Sonderfall" während der Vier-Mächte-Besetzung (1945-1955) und dann als Neutraler im Kalten Krieg als "Sonderfall" - nennen wir es "Austro-Exzeptionalismus". Die USA tolerierten Österreichs wachsende Handelsbeziehungen mit Osteuropa in den 1970er Jahren, betrachteten aber die österreichischen High-Tech-Exporte in den kommunistischen Block in den 1980er Jahren unter Reagan mit Argwohn. Kulturell prägte eine weitgehende Amerikanisierung die junge Generation Österreichs, die die USA quasi zu einer "kulturellen Supermacht" machte. Österreich machte sein Versäumnis, sich in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft zu integrieren, dadurch wett, dass es sich eng an die westdeutsche Wirtschaft anlehnte; während es während des Besatzungsjahrzehnts und darüber hinaus als "heimlicher Verbündeter" des Westens fungierte, hielt es seine Verteidigungsausgaben auf ein Minimum. Die österreichischen Verteidigungsausgaben während des Kalten Krieges reichten nie aus, um seinen neutralen Status im Falle eines Angriffs glaubhaft zu verteidigen.
Die österreichische Neutralität war mit einem Beitritt zur NATO und den von ihr ausgehenden transatlantischen Strukturen und Netzwerken unvereinbar. Das Ende des Kalten Krieges (1989-1991) veränderte sowohl die internationale Position der USA als auch Österreichs dramatisch. Die Vereinigten Staaten wandelten sich zu einem hegemonialen Riesen (der französische Außenminister Hubert Védrine bezeichnete die USA als "Hypermacht"), während Österreich der Europäischen Union beitrat und ein kleiner Akteur (in der EU und in der Welt insgesamt) blieb. Seit der Präsidentschaft von George H.W. Bush spielt Österreich in der Geopolitik der USA eine weniger bedeutende Rolle.
Während der dramatischen Ereignisse von 1989/90 war die Bush-Administration auf den Zusammenbruch des Kommunismus in den sowjetischen Satellitenstaaten und die deutsche Wiedervereinigung fokussiert und hat Österreich praktisch ignoriert. Auf der mentalen Landkarte amerikanischer Entscheidungsträger wurde Österreich von seiner mitteleuropäischen Position zunehmend als westeuropäische Nation wahrgenommen (als Teil der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaften). In der Zwischenzeit wurde das ehemals kommunistische "Osteuropa" zu "Mitteleuropa" - wir sprechen hier von den neuen postkommunistischen Ländern Ostmitteleuropas, die sich auf die NATO und die EU zubewegten.
1989, als der Eiserne Vorhang fiel, richtete Österreich seine Außenpolitik sowohl auf Mittel- als auch auf Westeuropa aus. Es baute die traditionellen Beziehungen zu seinen ostmitteleuropäischen und westlichen Balkan-Nachbarn wieder auf, verstärkte die Handels- und Bankbeziehungen und investierte massiv in die neuen Märkte des ehemals kommunistischen Osteuropas, während es gleichzeitig seine wirtschaftliche Integration in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft vollendete. 1995 trat Österreich der Europäischen Union und ihrer sich entwickelnden "Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik" sowie (später mit dem Vertrag von Lissabon) der "Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik" bei. Als Teil der sich ständig vertiefenden politischen, militärischen und wirtschaftlichen Integration Europas richtete Wien seine Außenpolitik neu auf Brüssel aus und löste sich aus der Umarmung Washingtons, die sich seit den Reagan-Jahren ohnehin gelockert hatte.
Österreich strebte eine vollständige politische und wirtschaftliche Integration mit Westeuropa an. Aufgrund der anhaltenden Beliebtheit der Neutralität bei zwei Dritteln der Bevölkerung ist Österreich jedoch nie Mitglied der NATO geworden und hat somit seine Sicherheitspolitik nie vollständig auf die atlantische Gemeinschaft ausgerichtet; in diesem Sinne ist es nie vollständig im Westen "angekommen". Am 1. März 2007 wurde das österreichische Außenministerium in "Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten" umbenannt.
This name change reflects the growing importance of “EUropean [=EU-European] affairs” and the relative decline of all other foreign-policy priorities. It also reflects a fear of the conservative People’s Party to lose EU competencies to the Social Democratic Chancellor. Yet, after 1995, Austria aligned itself with EU foreign policy. This made Austria part and parcel of the transatlantic-structures-sans-NATO- membership, including the dramatic ups and downs of transatlantic relations during the Clinton and Bush II years. Once it embraced EU integration, Austria lost its “special” Cold War international standing, namely its East-West bridge-building function and its status of “Austro-exceptionalism.”
During the Cold War, the Austrian embassies in Washington and Moscow served as the most important diplomatic missions abroad. After 1995, the Brussels Representation received highest priority among foreign missions. Moreover, the Lisbon Treaty (2009) established the “European External Action Service,” which marks the beginning of a EUropean diplomatic service that is bound to further absorb Austrian foreign policy into the common EUropean foreign policy agenda.
On their stopovers in Europe these days, American presidents visit Prague and Warsaw rather than Vienna. While bilateral economic and cultural relations are holding their own, political relations are weakening between Austria and the U.S. During the first half of the Cold War, Washington regularly posted topnotch professional foreign-service officers such as Llewelyn “Tommy” Thompson and H. Freeman Mathews as ambassadors to Vienna.
On Washington’s foreign policy priority list small nations like Austria have become less important. American presidents since Richard Nixon have dispatched political appointees to Vienna. After the end of the Cold War, all U.S. ambassadors to Austria have been wealthy political appointees who received ambassadorial appointments as a result of their big campaign contributors and “bundlers” in successful presidential campaigns.
Ambassadorial appointments have been important indicators of Austria’s relative standing on the Washington totem pole of global significance. Meanwhile, the Austrian governments have consistently been posting top diplomats as ambassadors to Washington, signaling the continued importance of Washington for Austria.
Frauen-Power asserted itself in both foreign ministries, the Ballhausplatz/ Minoritenplatz in Vienna and in Washington’s Foggy Bottom. For the first time in history, women became principal diplomatic actors on both sides of the U.S.–Austrian relationship. Prominent women ambassadors were appointed by the Austrian and American governments (Eva Nowotny, Swanee Hunt, Susan Rasinski McCaw) as were the first female secretaries of state/ foreign ministers. President Bill Clinton promoted Madeleine Albright, his U.N. Ambassador (1993-1997), to become the first female Secretary of State (1997-2001). President George W. Bush appointed his NSC-Adviser Condoleezza Rice (2001- 2005) as his Secretary of State (2005-2009) during his second term. President Obama made his rival in the 2008 campaign, Hillary Rodham Clinton, his Secretary of State (2009-2013). Chancellor Wolfgang Schüssel promoted two career diplomats to the position of Foreign Minister: Benita Ferrero- Waldner (2000-2004) and his former Chief-of-Staff Ursula Plassnik (2004-2008).
However, foreign policies did not markedly change or soften under female leadership, maybe because the foreign ministry staffs continued to remain largely male bastions of power. Particularly Albright and Rice were as militant in their conduct of U.S. foreign policy as their male counterparts, if not more so. Ferrero-Waldner and Plassnik were often overshadowed by Schüssel’s dominant role in foreign policy, especially in EU policies.
The U.S.–Austrian relationship, a small cog in the wheels of EUropean– American relations, became part of the growing transatlantic turmoil. U.S.–European relations since the end of the Cold War were a story of divergence, disagreement, and at times overt hostility. The everyday flow of bilateral U.S.–Austrian relations during the presidencies of George H.W. Bush, William Jefferson “Bill” Clinton and George W. Bush were rocked by significant international crises that reoriented and redefined the Austrian-American bilateral relationship too. As American foreign policy turned more unilateral after the end of the Cold War, it also became more imperial.
These, then, were the significant markers and turning points that contributed to a steady deterioration of transatlantic relations: 1) the end of the Cold War and the fall of the Iron Curtain from 1989 to 1991; 2) the breakup of Yugoslavia and the Bosnian crisis from 1991 to 1995 and the Kosovo war in 1999; 3) the formation of the Schüssel coalition government with the right-wing FPÖ in January 2000 and the subsequent international isolation of Austria; 4) the terrorist attacks of September 11, 2001, on New York and Washington and the subsequent in Europe unpopular “wars of preemption” against Afghanistan and Iraq. “Bush’s wars” in the Middle East produced the worst transatlantic discord since the Vietnam War and split Europe into U.S.-critical “old” and U.S.-friendly “new” Europe and unleashed a global wave of anti-Americanism, spilling over into Austria as well.
While Barack Obama’s election aroused great expectations in Austria, the Obama administration has been paying little attention to Austria. As President Obama has been “pivoting” his foreign policy from the Atlantic to the Pacific, the entire transatlantic partnership has lost its former significance. While writing about very recent contemporary history can be treacherous terrain for historians used to digging up the primary records in archives, a “first draft of history” is possible. Online newspaper archives and other online sources such as the homepages of Presidential Libraries and the extensive treasure trove of Wikileaks cables are available.
Peter Moser, the former Austrian Ambassador to the United States (1999-2003), published his memoirs and donated his personal papers to Center- Austria at the University of New Orleans. American politicians and diplomats have a strong democratic sense of obligation towards the attentive public and regularly explain their politics and world views in voluminous memoirs. Austrian politicians and diplomats rarely do so. Looking at the memoirs/autobiographies by Presidents William Jefferson Clinton and George W. Bush, along with key cabinet members such as Madeleine Albright,Warren Christopher, Condoleezza Rice, Donald Rumsfeld, Richard Cheney, Richard Holbrooke and George Tenet, one is left with the impression that Austria is but a small blip on Washington’s radar. Thousands of pages of memoirs contain only three meager references to “Austria.” There is considerable secondary literature both on Austrian and American foreign policy during the post- Cold-War era in general but hardly any on U.S.–Austrian relations in particular.
Kontinuität und Zusammenarbeit
Am 15. Mai 1955 unterzeichneten die USA den Österreichischen Staatsvertrag, der die Viermächtebesetzung beendete und Österreich zu einem freien, unabhängigen und neutralen Staat erklärte. Aufgrund der Neutralität Österreichs wurde Wien häufig als Austragungsort für wichtige Gipfeltreffen der Supermächte und als offizieller Sitz für multilaterale und internationale Organisationen gewählt. Zusätzlich zur bilateralen Mission in Österreich unterhält das US-Außenministerium Botschaften bei den Vereinten Nationen in Wien (UNVIE) und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).
Auch wenn die jeweiligen Ansätze in regionalen und internationalen Fragen manchmal voneinander abweichen, teilen die Vereinigten Staaten und Österreich viele gemeinsame Werte und Perspektiven: Unterstützung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit, Engagement für die Verringerung der Bedrohungen durch den Klimawandel und die Verbreitung von Atomwaffen sowie eine gemeinsame Vision von Frieden und Freiheit für alle. Österreich und die Vereinigten Staaten sind Partner bei der Förderung der globalen Sicherheit und des Wohlstands und arbeiten bei der Bewältigung globaler Probleme wie Terrorismus, illegaler Drogenhandel, organisiertes Verbrechen und Menschenhandel zusammen.
Die beiden Länder sind durch familiäre Bindungen, zwischenmenschlichen Austausch und Kontakte in den Bereichen Wirtschaft, Kunst, Bildung und Forschung, Sport und Freizeit miteinander verbunden. Im vergangenen Jahr besuchten mehr als 175.000 Österreicher die USA, und fast 500.000 Amerikaner besuchten Österreich.